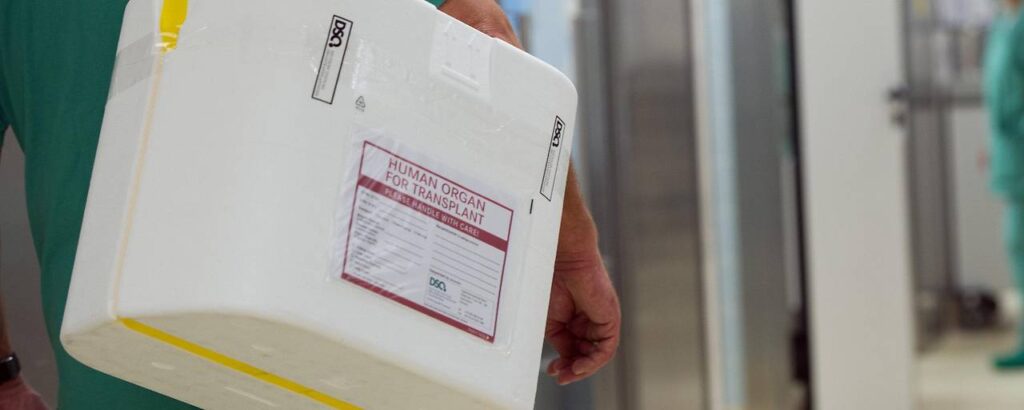In Österreich gilt man nach dem Tod automatisch als Organspender, wenn man nicht zu Lebzeiten widerspricht. Eine neue Studie zeigt, dass diese „Opt-out“-Regelung nicht automatisch die Zahl der Organe für Transplantationen erhöht.
Studie zur Organspende: Opt-out-Regelung zeigt unerwartete Effekte
In Österreich gilt die Regelung, dass man nach dem Tod automatisch als Organspender betrachtet wird, sofern man zu Lebzeiten nicht widerspricht. Eine neue Studie, die von einem Team unter der Leitung von Pascal Güntürkün an der Wirtschaftsuniversität Wien durchgeführt wurde, zeigt jedoch, dass diese „Opt-out“-Regelung nicht zwangsläufig zu einer Erhöhung der verfügbaren Organe für Transplantationen führt.
Untersuchung der Auswirkungen der Opt-out-Regelung
Die Studie analysierte die Auswirkungen auf die Zahl der postmortalen und lebenden Organspender in Ländern, die in den letzten zwei bis fünf Jahren von einer Zustimmungslösung zu einer Widerspruchslösung gewechselt sind. Diese Umstellung sollte eigentlich die Zahl der postmortalen Spender erhöhen, da jeder automatisch als Spender registriert wird. Laut Güntürkün betrifft dies in Österreich 99,5 Prozent der Bevölkerung.
Allerdings zeigt die Forschung, dass die Zahl der Lebendspenden im Durchschnitt um 29 Prozent zurückging, während die postmortalen Spenden lediglich um sieben Prozent anstiegen. Dies ist auf zwei Hauptfaktoren zurückzuführen: medizinische Kriterien und psychologische Aspekte. „Nur weil 99 Prozent der Menschen potenziell als Spender infrage kommen, bedeutet das nicht, dass sie auch tatsächlich geeignet sind“, erklärt Güntürkün. Zudem werde in vielen Ländern trotz der Opt-out-Regelung auch die Zustimmung der Familie eingeholt, was eine Entnahme verhindern kann.
Verdrängungseffekt bei Lebendspenden
Eine Umfrage mit über 5.000 Teilnehmern bestätigte den sogenannten Verdrängungseffekt: Der Eindruck, dass nun ausreichend Organe zur Verfügung stehen, führt dazu, dass die Bereitschaft zur Lebendspende sinkt. Dies gilt jedoch nicht für enge Familienangehörige, bei denen die Bereitschaft zur Spende unabhängig von der geltenden Regelung hoch bleibt. „Ob ich meinem Sohn oder meiner Tochter eine Niere spende, ist unabhängig von der geltenden Regelung“, so Güntürkün. Bei Cousins, Bekannten oder Freunden sieht die Situation jedoch anders aus.
Empfehlungen für begleitende Maßnahmen
Der Experte betont, dass die Opt-out-Regelung an sich sinnvoll ist, jedoch begleitende Maßnahmen erforderlich sind, um die negativen Nebeneffekte abzumildern. Eine zu optimistische Einschätzung der Auswirkungen dieser Regelung könnte die Zahl der Lebendspenden weiter verringern.
In Österreich, im Gegensatz zu Deutschland, wo eine aktive Zustimmung erforderlich ist, gilt das Opt-out-Prinzip. Im vergangenen Jahr wurden in Österreich 579 Transplantationen mit Organen von Verstorbenen durchgeführt, während 58 Organe von Lebendspendern stammten. Zum Ende des Jahres 2024 waren 66.192 Personen im Widerspruchsregister eingetragen.
Die Ergebnisse dieser Studie werfen wichtige Fragen zur Effektivität der aktuellen Regelung auf und verdeutlichen die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Förderung der Lebendspende.